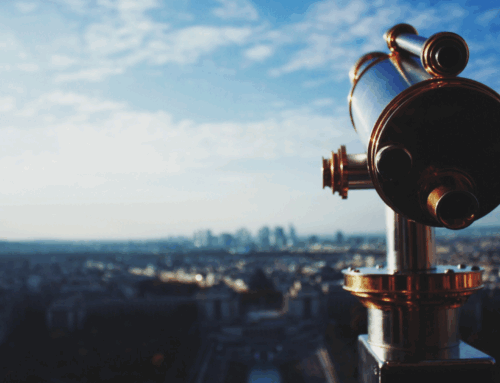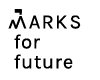Führungsdilemma in Reinform: „Ich weiß, ich soll mein Team coachen, aber wenn ich das tue, platzt die Deadline.“
Der Auftrag war klar: Eigenverantwortung stärken, nicht mit Vorgaben führen, sondern durch begleitendes Coaching. Das System dahinter war ebenso klar: ein fester Abgabetermin, Engpässe und hoher Druck. Am Ende legte die Führungskraft selbst Hand an, übernahm operative Aufgaben und schob das Coaching zur Seite.
Das Ergebnis war solide, nur gelernt hatte kaum jemand. Genau dieses Führungsdilemma setzt sich leise fest.
Das Führungsdilemma benennen
Moderne Führung setzt auf Coaching, Fragen, Entwicklung. Organisationen messen jedoch überwiegend, was schnell sichtbar ist: Lieferfähigkeit, Termine, Output. Beides ist richtig. Beides gehört zur Rolle. Aber selten ist beides gleichzeitig in hoher Qualität möglich.
Coaching folgt der Logik von Beziehung und Entwicklung. Es braucht Aufmerksamkeit, Geduld und die Bereitschaft, Umwege zuzulassen.
Liefern folgt der Logik von Struktur und Tempo. Es braucht Entscheidungen, Eingriffe und manchmal die direkte Übernahme. Wer in diesem Führungsdilemma beides zugleich maximieren will, verliert Wirkung auf beiden Seiten.
Der Anspruch, coachingorientiert zu führen, ist sinnvoll solange Raum dafür vorhanden ist. Unter hohem Zeitdruck wird er zum Bumerang. Aus der Absicht, Verantwortung abzugeben, wird die Rücknahme eben dieser Verantwortung. Schritt für Schritt wandert Arbeit zurück zur Führungskraft: korrigieren, neu verteilen, selbst erledigen. Das Team bleibt abhängig, die Führungskraft überlastet. Auch das ist Ausdruck des Führungsdilemmas und nicht etwa persönliches Versagen.
Systemlogiken statt persönlicher Makel
Führung findet nie im luftleeren Raum statt. Prozesse, KPI-Rhythmen, Berichtspflichten und Ressourcenknappheit senden klare Signale: Lieferung zählt. Selbst dort, wo Coaching und Empowerment offiziell betont werden, gewinnt in der Praxis oft das Dringende vor dem Wichtigen.
Helmut Schmidt hat es nüchtern zusammengefasst:
„In der Krise beweist sich der Charakter.“
Gemeint ist nicht heroische Dauerpräsenz, sondern die Fähigkeit, unter Druck klar zu entscheiden, was jetzt wirklich zählt und wofür es später Raum braucht.
Der Punkt der Klarheit
Wirksam wird Führung dort, wo die Spannung nicht überdeckt, sondern entschieden wird. Die Leitfrage lautet nicht: „Wie geht beides gleichzeitig?“
Die Leitfrage lautet: „Was hat jetzt Vorrang und mit welcher Begründung?“
Wenn der Termin kritisch ist und der Schaden eines Verfalls hoch, kann klare Steuerung sinnvoller sein als halbherzige Coachinggespräche zwischen zwei Meetings. Wenn der operative Druck beherrschbar ist oder Entwicklung bewusst höher gewichtet wird, verdient Coaching einen geschützten Rahmen ohne ständige Unterbrechung durch operative Eingriffe. Das Führungsdilemma löst sich nicht durch mehr Aktivität, sondern durch klare Priorität.
Prioritäten sichtbar machen
Prioritätensetzung bleibt wirkungslos, wenn sie unsichtbar bleibt. Entscheidend ist, sie transparent zu machen – nach innen und nach oben.
Gegenüber dem Team schafft eine klare Prio-Setzung Orientierung: Heute steht Lieferung im Vordergrund, in der Folgewoche wird die Aufgabe gemeinsam reflektiert und Verantwortung bewusst zurückgegeben. Gegenüber der eigenen Führung ist Rückmeldung Pflicht. Der gleichzeitige Anspruch „coachen und liefern“ ist in dieser Konstellation nicht realistisch. Entweder Ressourcen, Umfang oder Zeitpunkt ändern oder Coaching wird bewusst nachgelagert.
Coaching als Investition
Coaching ist kein Dekoelement. Es zahlt auf die Geschwindigkeit von morgen ein: bessere Entscheidungen, weniger Nacharbeit, mehr Verantwortlichkeit im Team. Als Investition braucht es Budget, vor allem Zeitbudget. Wer Coaching ernst nimmt, strukturiert es wie jeden anderen wertschöpfenden Prozess: feste Zeitfenster, klare Ziele, saubere Auswertung.
„Es gibt nichts Gutes, außer: man tut es.“ (Erich Kästner)
Entwicklung geschieht nicht im Vorbeigehen. Sie braucht bewusste Aufmerksamkeit oder sie bleibt ein Versprechen.
Die erwachsene Lösung
Die Führungskraft aus der Eingangsszene traf am Ende eine klare Entscheidung: Heute liefern, morgen entwickeln. Der Abgabetermin wurde gehalten. In der Folgewoche wurde die Aufgabe mit dem Team rekonstruiert: Wo hakte es? Welche Entscheidungen hätten die Mitarbeitenden selbst treffen können? Welche Informationen fehlten? Verantwortung wurde als konkret vereinbarte nächste Zuständigkeit zurückgegeben. Perfekt ist das nicht, aber erwachsen und eine reale Antwort auf das Führungsdilemma im Alltag.
Fazit
Coachen oder liefern ist oft keine Stilfrage, sondern eine Entscheidung unter Bedingungen. Führung profitiert davon, wenn diese Entscheidung rechtzeitig, begründet und sichtbar erfolgt. Wer versucht, alles gleichzeitig zu tun, verliert Orientierung – im Team und bei sich selbst. Wer priorisiert, gewinnt Wirkung zurück: heute durch saubere Lieferung, morgen durch gewachsenes Können.