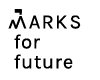Wenn Verantwortung in Führungsteams verdampft
Führungsteams sind das Herzstück von Organisationen. Sie sollen den Kurs setzen, strategische Entscheidungen treffen, Orientierung geben. Auf dem Papier ist das ein Ort kollektiver Verantwortung. In der Realität sieht es oft anders aus. Sitzungen sind geprägt von langen Agenden, intensiven Diskussionen – und am Ende erstaunlich wenig greifbarer Führung. Verantwortung bleibt in der Runde hängen.
Management oder Leadership?
Hier zeigt sich ein entscheidender Unterschied. Management sorgt dafür, dass Prozesse laufen, Abstimmungen koordiniert werden, Stränge zusammengeführt werden. Leadership hingegen bedeutet, Verantwortung sichtbar zu übernehmen und Entscheidungen auch dann zu vertreten, wenn sie unbequem sind.
In vielen Führungsteams verschwimmen diese Ebenen. Strategische Fragen werden diskutiert, aber nicht wirklich entschieden. Sie wirken nach außen wie Top-Management, im Kern bleibt es häufig bei Koordination. Einzelthemen werden individuell vorangetrieben, in späteren Terminen wieder zusammengetragen und genau dabei verliert sich der strategische Blick. Der Anspruch auf kollektive Verantwortung bleibt bestehen, doch die tatsächliche Führung verdampft.
Warum Verantwortung im Kollektiv ausbleibt
Dahinter stecken bekannte Muster: Das Harmoniebedürfnis, das Konflikte scheut. Machtspiele, die Verantwortung taktisch verschieben. Unklare Rollendefinitionen, die niemandem zutrauen, Haltung sichtbar zu zeigen. Und nicht zuletzt der Reflex zur Selbstorganisation, der Abstimmung mit Führung verwechselt.
Peer-Führung wirkt modern, ist in der Praxis aber oft nicht mehr als Koordination. Aufgaben werden verteilt, Zuständigkeiten besprochen, Beschlüsse gefasst. Doch Führung heißt nicht, Prozesse zu organisieren. Führung heißt, Verantwortung für Richtung und Wirkung zu übernehmen – im Namen des Ganzen.
Top-Team oder Show-Veranstaltung
So entstehen Führungsteams, die mehr Bühne als Steuerung sind. Nach außen demonstrieren sie Geschlossenheit, nach innen sichern sie Harmonie. Was fehlt, ist die klare, manchmal unbequeme Entscheidung. Die Folge: Orientierung geht verloren, operative Themen dominieren, die strategische Flughöhe schwindet.
Ein „Top-Team“ verdient seinen Namen erst dann, wenn es nicht nur die Bühne bespielt, sondern das Ganze im Blick behält und den Mut hat, Verantwortung sichtbar zu übernehmen.
Wie kollektive Führung gelingt
Kollektive Verantwortung entsteht dort, wo Rollen klar sind und wo Einzelne das strategische Zielbild verlässlich im Blick halten. Ohne solche Ankerpersonen verliert sich das Team in Einzelsträngen.
Hilfreich kann es sein, externe Impulse oder Sparringspartner einzubeziehen. Nicht, weil das Team unfähig wäre, sondern weil Außenperspektive blinde Flecken sichtbar macht. Moderation oder Sparring können dazu beitragen, dass Verantwortung nicht zwischen den Stühlen liegen bleibt, sondern verankert wird.
Führung im Kollektiv verlangt außerdem die Fähigkeit, Spannungen auszuhalten und produktiv zu nutzen. Ausführlicher habe ich diesen Aspekt bereits in einem früheren Blog beschrieben: Führen in Unsicherheit. Für Führungsteams heißt das vor allem: nicht auf perfekte Einigkeit warten, sondern Führung sichtbar machen – auch bei Dissens.
Verantwortung lässt sich nicht moderieren
Führungsteams ohne Führung wirken nach außen glatt, aber nach innen leer. Verantwortung verschwindet dort, wo sie in der Runde verdampft. Echte kollektive Verantwortung bedeutet, Haltung zu zeigen, den strategischen Blick zu bewahren und das Ganze im Blick zu halten.
Klarheit entsteht nicht durch Protokolle oder Agenden, sondern dadurch, dass Menschen bereit sind, Verantwortung sichtbar zu tragen. Am Ende zählt nicht, wie harmonisch ein Führungsteam wirkt. Am Ende zählt, ob es tatsächlich führt. Verantwortung lässt sich nicht wegmoderieren – sie muss angenommen werden.