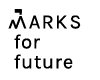„Ich merke, dass ich mich innerlich entferne.“ Dieser Satz fällt oft leise, innerlich und manchmal fast entschuldigend. Er beschreibt ein Dilemma, das in Führungsetagen häufiger vorkommt, als man zugibt: Der eigene Kompass und die Erwartungen des Systems laufen auseinander. Anpassung wird zum Zwang, Loyalität zur Pflicht und irgendwann stellt sich die Frage: Wo endet das Mitgehen und wo beginnt der Selbstverrat?
Das System verlangt Loyalität
Organisationen belohnen Konformität. Wer sich einfügt, gilt als zuverlässig, als teamfähig, als „loyal“. Doch diese Loyalität richtet sich selten an Sinn, Kunden oder Menschen. Sie gilt meist dem System selbst, seinen Routinen, Ritualen und unausgesprochenen Regeln.
In Leitbildern und Hochglanzbroschüren finden sich oft andere Worte: Werte wie Transparenz, Respekt oder Nachhaltigkeit. Doch im Alltag sind es nicht selten Kontrolle, Status oder kurzfristige Ergebnisse, die das Handeln bestimmen. Die Diskrepanz zwischen definierten und gelebten Werten ist einer der Momente, in denen Loyalität kippt: Man soll mittragen, was nicht überzeugt.
Wenn Werte nicht mehr passen
Führungskräfte spüren diesen Bruch, wenn das, was offiziell propagiert wird, mit dem eigenen Wertesystem kollidiert. „Wir reden über Vertrauen, aber es wird permanent kontrolliert.“ „Wir schreiben Respekt groß, aber Entscheidungen werden über Köpfe hinweg getroffen.“ Solche Spannungen nagen leise an der inneren Integrität.
Der Loyalitätskonflikt entsteht, wenn man sich für das System einsetzt, obwohl das eigene Bauchgefühl längst dagegenhält. Mitzutragen, was nicht stimmig ist, bedeutet Anpassung über den Punkt hinaus und der erste Schritt in Richtung Selbstverrat.
Anpassung im Fluss des Lebens
Diese Brüche haben nicht nur mit Organisationen zu tun, sondern auch mit der eigenen Lebensrealität. Anpassungsbereitschaft verändert sich. Ende zwanzig, ohne große Verpflichtungen, fühlt sich der Preis für Loyalität noch überschaubar an. Ende dreißig oder Anfang vierzig, mit Familie im Rücken, sieht das schon anders aus. Mitte fünfzig, mit Verantwortung für alternde Eltern, verschieben sich Prioritäten erneut.
Hinzu kommt die persönliche Entwicklung. Wer sich über Jahre hinweg weiterentwickelt, hinterfragt automatisch, was früher stimmig schien. Was einmal Karriereschritt war, wirkt später wie Selbstaufgabe. Die eigene Biografie verändert, was man bereit ist zu tragen und was nicht mehr.
Der Kipppunkt
Bis zu einem gewissen Grad ist Anpassung unvermeidlich und erforderlich für erfolgreiche Führungskräfte, gerade im Top-Management. Und auch Systeme brauchen sie, sonst funktionieren sie nicht. Doch es gibt einen Punkt, an dem Anpassung zur Selbstverleugnung wird. Dann kostet Loyalität zu viel.
Symptome erstrecken sich über innere Distanz, Zynismus, eine zunehmende Sprachlosigkeit in Meetings bis hin zu körperlichen Symptomen. Nach außen läuft alles weiter, doch innerlich wächst die Kluft. Der Preis: Glaubwürdigkeit geht verloren – zuerst für einen selbst, später auch für andere. Mitarbeitende, KollegInnen und die eigene Führungskraft spüren oft sehr genau, wenn Menschen nicht mehr hinter ihren Entscheidungen stehen.
Folgen im System und für die Person
Nach außen wird Loyalität oft gelobt. Doch wenn sie zur Maske wird, entsteht im Inneren Leere. Führungskräfte berichten von Erschöpfung, Sinnverlust, manchmal von einer leisen Resignation. Das Paradoxon: Die Loyalität, die nach außen Stabilität geben soll, zerstört nach innen Bindung und Kraft.
Wege aus dem Loyalitätskonflikt
Der erste Schritt liegt darin, die Spannung nicht kleinzureden. Loyalitätskonflikte sind kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck von Entwicklung, sei es durch veränderte Werte, durch neue Lebensumstände oder durch den Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
Klarheit braucht Räume, in denen solche Fragen gestellt werden dürfen. Das können Sparringspartner sein, interne wie externe, die einen Blick von außen ermöglichen. Es geht nicht darum, sofort in Opposition zu gehen, sondern darum, den Punkt zu erkennen, an dem Anpassung den eigenen Kern bedroht.
Fazit
Anpassung gehört zum Funktionieren von Organisationen. Doch sie darf nicht in Selbstverrat münden. Werte verschieben sich, Lebensumstände verändern sich, Systeme fordern mehr, als man geben kann. Loyalität bedeutet nicht, sich selbst aufzugeben.
Führung bleibt nur dann integer und wirksam, wenn Integrität spürbar bleibt. Und manchmal beginnt das genau in dem Moment, in dem man leise feststellt: „Ich merke, dass ich mich innerlich entferne.“
Siehe auch: Wie unsere Werte unsere Karriere beeinflussen; Werte im Kreuzfeuer: Wie Führung mit dem Diversity Backlash umgeht