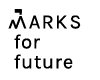Viele Führungskräfte kontrollieren, obwohl sie Vertrauen fördern wollen. Dieser Artikel zeigt, wie bewusste Steuerung gelingt – im Denken, Fühlen und Handeln.
Zwischen Theorie und Führungsalltag klafft eine Lücke
Führungskräfte kennen die Prinzipien wirksamer Führung: klare Kommunikation, Vertrauen, Feedback auf Augenhöhe. Viele haben Trainings besucht, Bücher gelesen, Methoden gelernt – und doch erleben sie sich im Alltag oft reaktiv, angespannt oder kontrollierend. Was im Seminar klar war, verflüchtigt sich im Spannungsfeld zwischen E-Mail-Flut, Teamkonflikten und Entscheidungsdruck.
Woran liegt das?
In den meisten Fällen auf jeden Fall nicht am fehlenden Wissen sondern daran, dass Erkenntnis allein keine Veränderung schafft. Wirkung entsteht erst, wenn Einsicht verkörpert wird – im Verhalten, im Nervensystem, in der Haltung. Genau hier liegt der Schlüssel: Führung ist kein kognitives Konzept. Sie ist verkörperte Praxis.
Kontrolle gibt Sicherheit – aber zu welchem Preis?
Unsicherheit und Komplexität fördern einen Führungsstil, der nach Kontrolle ruft. Kontrolle erscheint auf den ersten Blick als zuverlässige Strategie: Sie prüft, greift ein, bewertet. Sie verlangt nach messbaren Vorgaben und überprüfbaren Ergebnissen. Doch sie wirkt rückwärtsgewandt – sie sichert Bestehendes, anstatt Neues zu ermöglichen.
Steuerung ist das Gegenmodell. Sie orientiert sich an Zukunft, Entwicklung und Gestaltungsspielraum. Sie erfordert Klarheit, Vertrauen und eine Kommunikation, die nicht bewertet, sondern befähigt. Wer steuert, schafft Bedingungen für Eigenverantwortung.
Steuerung heißt nicht „laufen lassen“. Sie heißt: so viel Orientierung wie nötig – so viel Vertrauen wie möglich. Beides ist notwendig – aber in Momenten von Unsicherheit zeigt sich, worauf eine Führungskraft zurückgreift: auf strukturierende Kontrolle oder auf verbindende Präsenz. Letzteres verlangt mehr als Methodenwissen. Es braucht Verkörperung.
Neurobiologie trifft Führungsalltag
Die Neurowissenschaft spricht hier von verkörperter Selbstregulation: die Fähigkeit, unter Druck bewusst zu handeln – statt reflexhaft zu reagieren. Studien zeigen, dass regelmäßige Achtsamkeitspraxis die neuronale Aktivität in der Amygdala (Stresszentrum) reduziert und die Struktur des präfrontalen Kortex (Entscheidungsfähigkeit, Impulskontrolle) stärkt.
(Hölzel et al., 2011)
Das heißt: Führung, die wirklich wirkt, beginnt im Nervensystem. Wer unter Druck in seiner Mitte bleibt, gibt Orientierung. Wer selbst im Autopiloten-Modus agiert, wird versuchen, durch Kontrolle Halt zu gewinnen – und verstärkt damit Unsicherheit im System. (Mehr zum Thema auch in der Artikel-Serie „Die faszinierende Welt der Neuroplastizität„)
Was bewusste Steuerung konkret braucht
Klarheit – für sich selbst und andere
Führung ohne Klarheit endet in Mikromanagement. Wer Erwartungen nicht benennt, wird sie unbewusst kontrollieren. Steuerung beginnt mit dem eigenen Fokus: Was ist wirklich wichtig? Was ist das Ziel? Was ist nicht mehr mein Job?
Reflexionsfrage: Wo bin ich gerade unklar – und wie übersetze ich das (vielleicht) in Kontrolle?
Vertrauen – nicht als Gefühl, sondern als Entscheidung
Vertrauen in Teams entsteht nicht durch Appelle, sondern durch Erfahrung. Wer Vertrauen schenkt, statt Verhalten zu kontrollieren, signalisiert: „Ich traue dir Entwicklung zu.“ Das verändert Beziehungen – und erhöht Verantwortungsübernahme.
Praxistipp: Führe einen „Vertrauens-Check-in“ ein: Formuliere in Gesprächen bewusst, wo Du Zutrauen aussprichst – nicht nur Anforderungen.
Kommunikation – nicht als Korrektur, sondern als Ko-Konstruktion
Wer Feedback als gemeinsamen Lernprozess versteht, schafft Räume für Entwicklung. Das gelingt nicht mit starrer Bewertung, sondern mit Fragen, die Perspektiven eröffnen.
Beispiel für Feedback auf Augenhöhe: „Was hast Du aus der Situation mitgenommen?“ oder „Was brauchst Du, um beim nächsten Mal selbst zu entscheiden?“
Verkörperte Führung im Alltag: Drei Mikropraktiken
- Achtsamer Übergang vor Führungsmomenten (90 Sek.): Nimm zwei bewusste Atemzüge, spüre Deine Körperhaltung und dann frage Dich: „Will ich kontrollieren oder orientieren?“
- Mikro-Pause bei Kontrollimpulsen: Halte kurz inne bevor Du eingreifst und frage Dich: „Bin ich gerade unsicher – oder ist hier wirklich Steuerung notwendig?“
- Ritual zur Stärkung von Eigenverantwortung im Team: Starte Dein monatliches Check-in im Team mit der Frage: „Wo haben wir in letzter Zeit gute Steuerung erlebt – und wo eher Kontrolle?“ mit dem Ziel die Teamkultur zur reflektieren ohne die Schuld zuzuweisen.
Echte Führungsqualität zeigt sich im Moment, nicht im Modell
Wissen verändert noch nichts. Erst wenn Klarheit, Vertrauen und Kommunikation verkörpert werden, entstehen neue Handlungsspielräume. Kontrolle wirkt kurzfristig stabilisierend, aber langfristig begrenzend. Steuerung ist anspruchsvoller – sie verlangt Mut zur Unsicherheit und Präsenz im Jetzt.
Bewusst zu steuern heißt, loszulassen, ohne zu verlieren. Es heißt, sich selbst zu führen – und dadurch andere wachsen zu lassen.