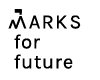Es gibt sie, diese Momente in der Führung, in denen innerlich alles in Bewegung gerät. Entscheidungen, die von „oben“ getroffen wurden, lassen sich nach außen vertreten – doch innerlich regen sich Zweifel. Der innere Widerstand ist spürbar, auch wenn er nicht laut wird. Und dennoch steht eine Kommunikation bevor: vor dem Team, in der Leitungsebene, manchmal auch nur im eigenen Kalender.
Gerade in solchen Situationen lohnt es sich, innezuhalten und bewusst nach innen zu hören.
Das Modell des Inneren Teams von Friedemann Schulz von Thun bietet einen hilfreichen Zugang, um die innere Zerrissenheit nicht als Schwäche zu deuten, sondern als Ausdruck innerer Differenziertheit. Es beschreibt die Vielstimmigkeit der eigenen Persönlichkeit – verschiedene Haltungen, Erfahrungen und Werte, die in bestimmten Situationen gleichzeitig aktiv werden und miteinander ringen. (siehe auch Blogartikel „Entscheidungen vertreten, die man innerlich ablehnt„)
Diese Stimmen sind keine Störung. Sie sind ein inneres Beratungsteam. Und wer sie wahrnimmt, gewinnt Klarheit – nicht unbedingt Harmonie, aber eine Haltung, die tragfähig ist.
Im Folgenden eine praktische Selbstreflexionsübung, die insbesondere in der Vorbereitung auf schwierige Gespräche im Team hilfreich sein kann.
1. Die Situation bewusst wählen
Zunächst wird eine konkrete Situation gewählt, in der eine Entscheidung nach außen vertreten werden muss, obwohl sie innerlich schwer mitzutragen ist. Etwa die Nicht-Nachbesetzung einer Stelle, eine umstrittene Maßnahme oder eine strukturelle Veränderung, die Fragen aufwirft.
2. Innehalten, ankommen und die inneren Stimmen sichtbar machen
Vor dem Einstieg lohnt sich ein Moment der Achtsamkeit. Einige tiefe Atemzüge helfen dabei, den Körper zu spüren und erste innere Reaktionen wahrzunehmen.
Dann geht es darum, die verschiedenen inneren Anteile zu identifizieren, die sich zur Situation äußern. Dies kann schriftlich erfolgen – mit Namen, Rollen oder Bildern.
Zum Beispiel:
- Die Loyale: „Diese Entscheidung ist gefallen – sie muss mitgetragen werden.“
- Die Fürsorgliche: „Das Team ist bereits überlastet – das ist kaum vermittelbar.“
- Die Rebellin: „Diese Maßnahme kann so nicht mitgetragen werden.“
- Die Strategin: „Zu viel Offenheit birgt persönliche Risiken.“
Diese Stimmen stehen stellvertretend für innere Haltungen, oft verbunden mit biografischen Erfahrungen, Werten oder auch Schutzmechanismen.
3. Den Stimmen Raum geben
Jede Stimme erhält für einen Moment das innere Mikrofon. Sie wird befragt:
- Was möchtest Du schützen?
- Was befürchtest Du?
- Für welchen Wert stehst Du?
- Welche Erfahrung steckt hinter Dir?
Auf diese Weise entsteht ein differenzierteres Bild der inneren Dynamik – und erste Hinweise auf das, was in dieser Situation wirklich auf dem Spiel steht.
4. Innere Moderation übernehmen
Im nächsten Schritt wird bewusst in die Rolle der inneren Moderatorin gewechselt. Welche Stimme darf gerade mehr Raum bekommen? Welche überzeichnet? Welche Perspektive fehlt möglicherweise noch?
Ziel ist nicht Konsens – sondern eine bewusste Auswahl: Welche Haltung kann in dieser Situation nach außen vertreten werden, ohne sich selbst zu verlieren?
5. Klärung vor der Kommunikation
Abschließend wird ein Satz formuliert, der nach außen kommuniziert werden kann – ein Satz, der innerlich mitgetragen wird.
Beispielsweise:
„Mir ist bewusst, dass diese Entscheidung schwer wiegt. Sie ist nicht ideal – aber sie steht. Was wir daraus machen, liegt in unserer Hand.“
Ein solcher Satz ist nicht glatt, nicht optimiert – aber er ist echt. Und genau das wird in Teams wahrgenommen.
Innen sortieren, außen glaubwürdig bleiben
Führung geschieht selten unter Idealbedingungen. Oft sind es Spannungsfelder, Ambivalenzen und widersprüchliche Anforderungen, die das tägliche Handeln prägen. Wer in solchen Momenten die eigenen inneren Stimmen kennt und in Beziehung zueinander bringt, kommuniziert nicht perfekt – aber stimmig.
Gerade in Zeiten von Unsicherheit und Wandel macht es einen Unterschied, ob jemand funktioniert oder aus einer reflektierten Haltung heraus handelt. Nicht jedes Problem lässt sich sofort lösen. Aber Klarheit darüber, was einem selbst wirklich wichtig ist, schafft Orientierung – für sich selbst und für andere.